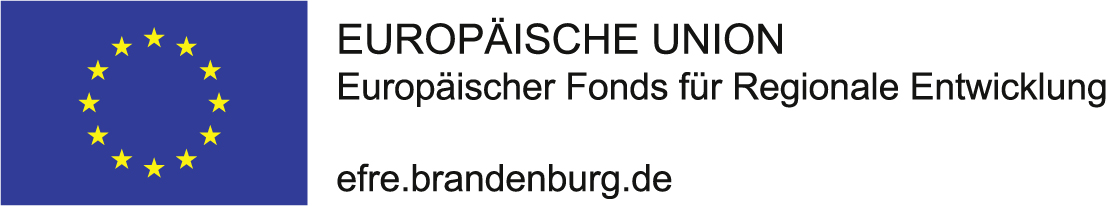Geothermie
Geothermie, auch Erdwärme genannt, ist die unterhalb der Erdoberfläche gespeicherte Wärmeenergie. Diese kann für das Beheizen von Gebäuden verwendet werden. Die Geothermie ist regional verfügbar, zuverlässig, grundlastfähig, landschaftsschonend, klimaneutral und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich.
Es gibt verschiedene Geothermieanlagen. Diese werden nach der Bohrtiefe wie folgt unterschieden:
Oberflächennahe Geothermie
Die oberflächennahe Geothermie nutzt Bohrungen bis in 400 m Tiefe oder Kollektorfelder unterhalb der Erdoberfläche. Eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert in einem Rohrsystem im Untergrund und nimmt die Wärme aus dem Boden auf. Diese Wärme wird an eine Wärmepumpe abgegeben, die die Wärme auf das benötigte Temperaturniveau erhöht. Typische Systeme sind Erdwärmesonden und Erdwärmesonden.
Tiefe Geothermie
Hydrothermale Systeme nutzen tiefliegende wasserführende Schichten zur Wärmegewinnung. Bei petrothermalen Geothermie Systemen wird nicht auf den natürlich vorhandenen Wasserdampf oder das Thermalwasser zurückgegriffen, sondern es wird die natürliche Wärme des heißen Gesteins in ca. 2.000 - 6.000 Meter Tiefe genutzt. Hierbei wird über eine Injektionsbohrung kaltes Wasser von der Erdoberfläche in die Gesteinsschichten gepresst, erwärmt sich dort und gelangt über eine Förderbohrung wieder an die Tagesoberfläche Die Verfahren der petrothermalen Geothermie werden daher auch als "Hot-Dry-Rock-Verfahren" bezeichnet.
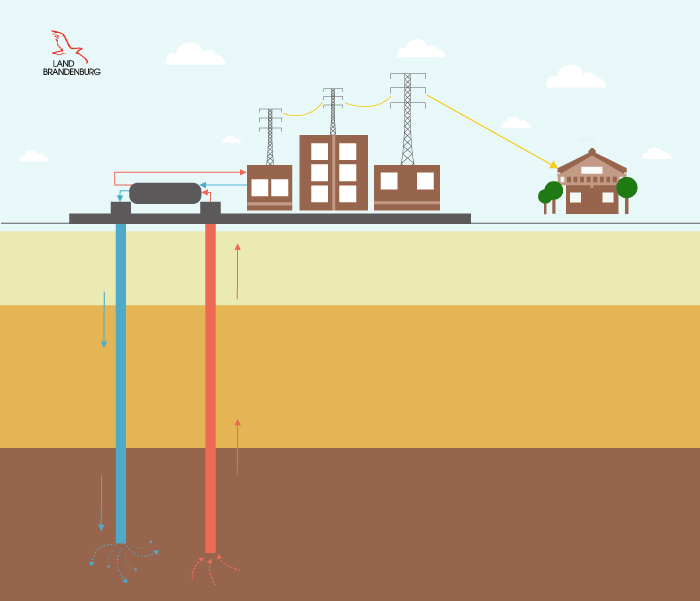 Für eine größere Darstellung bitte das Bild anklicken.
Für eine größere Darstellung bitte das Bild anklicken.
Geothermie in Brandenburg
In energieeffizienten Neubauten oder bei Umrüstung wärmetechnischer Anlagen in Bestandsgebäuden wird mittlerweile vermehrt auf die Erdwärmenutzung durch eine Erdwärmepumpe gesetzt. In Brandenburg gibt es mehr als 20.000 Erdwärmepumpen. Sie haben eine Leistung von durchschnittlich 7 kW, womit beispielsweise ein Einfamilienhaus komplett beheizt werden kann.
Geothermie-Forschungsplattform Groß Schönebeck: Das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam betreibt die Forschungsplattform Groß Schönebeck. Diese befindet sich 50 Kilometer nordöstlich von Berlin am südlichen Rand des Norddeutschen Beckens. Zwei Forschungsbohrungen erschließen wasserführende Schichten in Tiefen zwischen 3.900 und 4.400 m bei Temperaturen um 150 °C. Dort wurden alle Fragestellungen der geothermischen Energiebereitstellung unter natürlichen Bedingungen untersucht. Die wissenschaftlichen Arbeiten umfassten die sichere Erkundung potenzieller Reservoire und deren bohrtechnische Erschließung sowie Technologien zur nachhaltigen Nutzung von Wärme. Anhand von Bohrlochmessungen und 3D-Modellierungen wurde ein Abbild des geologischen Untergrundes erstellt.
Erdwärmesonde Prenzlau: In Prenzlau wird eine tiefe Erdwärmesonde betrieben, deren Wärme ins Fernwärmenetz eingespeist wird. Die Anlage mit einer Leistung von ca. 500 kW ist 1994 in Betrieb gegangen und liefert Wärme von jährlich rund 2.900 MWh. Die Wärmeleistung wird durch die Zuschaltung einer Wärmepumpe erreicht. Die Bohrtiefe beträgt 2.786 m und die Temperatur des Gesteins liegt bei 108 °C.
Geothermieprojekt der Stadtwerke Potsdam: In Potsdam wird zukünftig ein Neubauwohnviertel durch Wärme aus dem Untergrund klimaneutral beheizt. Ein geothermisches Heizwerk stellt die benötigte Wärmemenge aus einer Tiefe von 1076 Meter über eine Bohrung zur Verfügung. Das 47 °C warme Wasser wird durch Wärmepumpen auf ein nutzbares Temperaturniveau angehoben. Über einen Wärmetauscher gelangt die Wärme in das Niedertemperaturnetz des Wohngebietes. Die überschüssige Wärme soll in das Fernwärmenetz der Stadt eingespeist werden. Das abgekühlte Wasser wird über eine zweite Bohrung in das im Untergrund liegende Reservoir zurückgeführt.
Beispiele für große Geothermieanlagen in Brandenburg
- Uni-Campus in Potsdam/Golm mit einer Leistung von 1,8 MW
- Albert-Schweitzer-Haus in Teltow mit 180 kW (Wärmepumpe mit 30 Erdsonden in 99 m Tiefe)
- Heizwerk Neuruppin, Hydrothermale Dublette mit einer Leistung von 1,4 MW
Geothermieportal Brandenburg-Berlin
Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg betreibt das Geothermieportal.
Es bietet geologische Daten, die Aussagen über die Parameter eines Standortes zulassen. So erhalten Nutzer Informationen zur Verteilung der Wärmeleitfähigkeit im Untergrund, um Geothermieanlagen optimal auszulegen. Das Projekt wurde mit der Unterstützung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung realisiert.
Broschüre "Tiefengeothermie - Wärme für Brandenburg"
Das MWAE hat eine Broschüre zur Tiefengeothermie in Brandenburg erstellt. Diese enthält umfangreiche Informationen zu geologischen Verhältnissen in Brandenburg, rechtlichen Rahmenbedingungen, Genehmigungswegen und Ausführungsbeispiele.
Download: Tiefengeothermie- Wärme für Brandenburg (PDF)
Anforderungen des Gewässerschutzes für Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren
Eine Orientierungshilfe und Handlungsempfehlungen bei Anforderungen des Gewässerschutzes für Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren im Land Brandenburg finden Sie innerhalb des Intenetauftritts des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg.
Bohranzeige - Onlineanzeige nach dem Geologiedatengesetz für Brandenburg
Alle geologischen Untersuchungen, darunter insbesondere Bohrungen, müssen gemäß Geologiedatengesetz (GeolDG) und/oder Bundesberggesetz (BBerg, § 127) dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBRG) 14 Tage vor Beginn der Arbeiten angezeigt werden (§ 8 GeolDG).
Link zur Online-Bohranzeige
Förderung von Geothermievorhaben
Der Bund hat zur Förderung von Geothermievorhaben die beiden folgenden Förderprogramme geschaffen. Detaillierte Informationen finden Sie unter den verlinkten Webseiten des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)